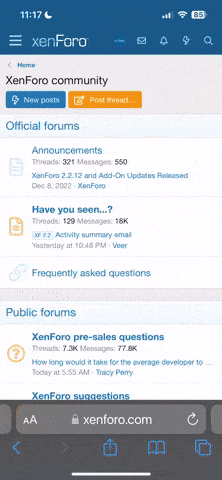Al Fifino
Rare-Mob
- Mitglied seit
- 18.08.2007
- Beiträge
- 446
- Reaktionspunkte
- 17
- Kommentare
- 35
- Buffs erhalten
- 44
@Albra: Ich hab's zumindest nicht vor.
Die Formatierung zerhaut mir übrigens gerade wieder meinen Text... mit Lücken zwischen jedem Absatz wird's immerhin ein wenig übersichtlicher. Bitte denkt nicht, dass ich das nur mache, um es wie mehr aussehen zu lassen, als es tatsächlich ist. Ich bin schlichtweg zu faul, all die Absätze wieder herauszulöschen, wenn das copy-paste immerhin schon so schön übersichtlich aufgedröselt wird.
PS.: Wenn ihr "plot holes" findet, sagt bitte umgehend Bescheid! Keine Lust, mich wieder im selben Mist zu verfangen wie das letzte Mal...
_____
Kapitel 8 – Eine neue Haut
Die nächsten Stunden vergingen wie im Flug. Ich konnte nicht einmal genau sagen, wie viele Tage sie bildeten, weil Undercity komplett von der Sonne abgeschnitten war. Ich zählte stattdessen Fackeln, die abbrannten, und Kohlepfannen, die aufgefüllt werden mussten. Fünf Fackeln waren schon zu kleinen Stümpfen verkommen und ausgetauscht worden seit meinem Ausflug ins Schurkenviertel.
Inessa hatte ich seitdem nicht wieder gesehen. Ohnehin hätte ich keine Zeit gehabt, mich mit ihr zu unterhalten: Direflesh hielt mich erbarmungslos auf Trab, verlangte Kräuter, die man nur in den hintersten Winkeln von Undercity finden konnte, forderte Eingeweide und Gedärme von Tieren, die beinahe ausgerottet waren, und ließ sich alles von mir liefern, ohne auch nur ein einziges Mal Dank zu zeigen. Zu allem Überfluss hatte er es sich auch noch in den Kopf gesetzt, mich stets mit einigen Flammenbällen zu begrüßen. Wahrscheinlich hoffte er, dass ich einmal zu spät ausweichen und mit einem Schlag verbrennen würde; zumindest seine Augen glitzerten stets mordlüsternd, wenn er mich ansah. Nach der ersten Attacke, der ich nur mit viel Glück entronnen war, lernte ich sehr schnell, mich ihm leise zu nähern und nicht allzu lange in seiner Nähe zu verweilen.
Doch so sehr ich das alte Gerippe verabscheute, musste ich dennoch zugeben, dass ich einige kleine Vorzüge genoss, seitdem ich ihm zwangsweise als Laufbursche diente. Zum einen war Direflesh eine stadtbekannte Figur; es genügte vollends, seinen Namen auszusprechen, und Gespräche verstummten. Die meisten der Untoten, die mitbekamen, dass ich für ihn arbeitete, bedachten mich mit einem hämischen Blick. Die wenigsten schienen damit zu rechnen, dass ich den nächsten Sonnenumlauf überleben würde. Andere, vor allem die wenigen Tauren, die ich zu Gesicht bekam, schienen dagegen regelrecht Mitleid mit mir zu haben. Wirte und Schankmeister gaben mir jedenfalls umsonst zu trinken, was ich wollte, entweder aus Mitleid oder aus Furcht. Ich genoss es, solange ich konnte.
Außerdem hatte ich Eintritt in das Refugium des Apothekers erhalten. Wenn man durch die Tür trat, fiel zuerst das bläuliche Netz auf, welches sich kaum sichtbar über den Eingang spannte. Direflesh hatte es mir gegenüber nur ein Mal erwähnt. Es schien all jene in kleine Würfel zu schneiden, die ohne seine Erlaubnis Zugang zu seinem Haus suchten. Von dem Netz abgesehen, glomm in jeder noch so winzigen Ecke des Hauses ein Zauber, von denen die meisten wohl zerstörerischer Natur waren. Nur die helle Lichtkugel, die an der Decke schwirrte und dem alten Griesgram auf Schritt und Tritt folgte, machte einen einigermaßen freundlichen Eindruck.
Das Haus, welches lediglich aus einem verlies-artigen Zimmer bestand, war spartanisch und nutzbringend eingerichtet. Es war praktisch leer, mit Ausnahme einiger gläserner Geräte und Röhrchen, einer Feuerstelle, über der ein rostiger und kaum gebrauchter Kessel hing, und einem riesigen Regal, in welchem Direflesh all das aufbewahrte, was ich ihm brachte. Süßlicher Verwesungsgestank erfüllte stets die Luft, ab und zu geschwängert von dem betörenden Duft fremder Kräuter. Direflesh schien nie zu schlafen, denn er hatte es nicht für nötig gehalten, ein Bett aufzustellen. Dafür führte eine verrottendeTür, die in dem großen Raum ein wenig falsch am Platz wirkte, in eine winzige Kammer, vollgestopft mit Büchern in fremden Sprachen und Sprachen, die ich sogar verstand. Einige dieser Bücher, die ich für interessanter hielt als die anderen, hatte ich kurzerhand eingesteckt, und jedes Mal, wenn ich mir eine kleine Pause zwischen meinen ewigen Botengängen leisten konnte, schmökerte ich in ihnen herum.
Eines hatte es mir besonders angetan. Es befasste sich mit der Kunst der Magie, vor allem der schwarzen Beschwörungsformeln. Schattenblitze waren illustriert dargestellt, mitsamt aller Wörter, die für den Zauber nötig waren, und den dazugehörigen Handbewegungen. Weiter hinten tauchten andere, nützliche Sprüche auf: etwa die Dämonenhaut, welche am ehesten einer magischen Rüstung ähnelte; oder die Beschwörung eines Leerwandlers, welcher den Befehlen seines Herren bedingungslos folgte und für ihn sogar bis zum Tod kämpfte. Gerade der Leerwandler weckte mein Interesse. Er hätte sich um meine Arbeiten kümmern können, während ich das Buch weiter gelesen hätte. Dummerweise verstand ich praktisch nichts von Magie und Beschwörungen, und obwohl ich danach stöberte, konnte ich in Direfleshs Bibliothek kein Buch finden, das mir die grundlegenden Dinge erklärt hätte.
Immer wieder war ich versucht, meinen neuen Meister einmal darauf anzusprechen. Aber jedes Mal hielt mich meine Furcht, ihm auch nur einen Schritt näher zu kommen als unbedingt notwendig, zurück.
Gerade stand ich wieder einmal vor dem Arbeitstisch des Untoten. Was auch immer er braute, es stank scheußlich nach Schwefel, Verfall und Tod. Angesichts dessen, was ich bisher schon im Apothekarium zu Gesicht bekommen hatte, ging ich davon aus, dass Direflesh besonders bösartige Experimente durchführen musste. Solange er jedoch nicht vorhatte, mir etwas von seiner Braukunst verabreichen zu wollen, war es mir ziemlich gleichgültig. Ich legte die kleine Phiole mit Gift, die er von mir verlangt hatte, neben den Überresten irgendwelcher grünlich schimmernden Gedärme, und ging dann rasch zur Tür hinüber.
Direflesh selbst schien sich in seiner Bibliothek aufzuhalten: Licht strahlte aus dem kleinen Raum und der halb geöffneten Tür hervor, und ich konnte hören, wie er achtlos einige seiner Bücher zu Boden warf. Ein Grunzen, dem eines zufriedenen Schweines nicht unähnlich, folgte, und der Apotheker trat wieder in sein Labor, wo er mich an der Pforte zur Freiheit stehend entdeckte. »Ah, du bist schon wieder zurück gekehrt. Tüchtig, tüchtig, der kleine Streuner…«
Er bleckte seine gelben Zähne und eilte zu seinem Tisch hinüber, wo er die Phiole zur Hand und die glasklare Flüssigkeit darin genauer in Augenschein nahm. »Das reine Gift einer Königskobra… was noch? Was könnte noch fehlen?«, murmelte er leise vor sich hin.
Ich beobachtete ihn genau. Direflesh hatte die Angewohnheit, reizbar zu werden, wenn er länger überlegen musste. Seine Wut ließ er gerne an den Wänden seines Hauses aus – die meisten der Steine waren schwarz verbrannt, als hätten unzählige Feuer an ihnen geleckt – und seit neuestem auch an mir.
Als er sich wieder an mich wandte, machte er zu meiner unendlichen Erleichterung einen ruhigen Eindruck, solange man einen Wahnsinnigen ruhig nennen konnte. »Ich muss nachdenken… und du störst mich dabei!«, brüllte er mich plötzlich an. Während ich noch erschrocken zusammen zuckte, hatte meine Hand bereits die Türklinke gefunden und nach unten gedrückt. Der Feuerball zischte über meinen Kopf hinweg, als ich mich hastig duckte, und durch die inzwischen offene Tür hinaus in das Apothekarium. Schreie und Rufe, nicht minder erschrocken wie ich, ertönten, bis das Klirren und Bersten von Glas zu vernehmen war.
»Raus! Verschwinde, und komm nicht vor morgen wieder, oder ich reiße dir deinen Kopf ab!«
Meine Augen wurden groß, als die Worte aus Direflehs Mund an meine Ohren drangen. »Natürlich, Meister!«, erwiderte ich ein wenig zu schnell, um meine Freude verbergen zu können. Einen Moment später rannte ich bereits durch den schlecht beleuchteten Gang in Richtung Äußeren Rings. Die Umhängetasche, die ich inzwischen erstanden hatte, um meine Bücher darin aufzubewahren, hüpfte auf und ab und brachte mich fast aus dem Gleichgewicht, aber ich war zu sehr damit beschäftigt, wenigstens für kurze Zeit aus Direfleshs eisernen Griff zu entfliehen, um darauf zu achten.
Erst, als ich das Apothekarium mit seinen finsteren Kammern und noch finstereren Bewohnern hinter mir gelassen hatte und wieder vor dem giftgrünen Kanal stand, zwang ich mich, stehen zu bleiben. Es benötigte einiges an Willenskraft, nicht in lauter Jubel auszubrechen und Luftsprünge zu machen; stattdessen folgte ich eilig und mit einem breiten Grinsen im Gesicht dem Fluss, bis ich eine der unzähligen und schlecht gewarteten Brücken fand und auf die andere Seite übersetzte. Nicht einmal die Leere der Katakomben Lordaerons konnte mir meine gute Laune nehmen, während ich meinen Weg fortsetzte.
Es dauerte nicht lange, bis ich die allmählich auftauchenden Giftmischereien und Geschäfte voller Halsabschneider hinter mir gelassen und in den gehobeneren Bereich Undercitys eingedrungen war. Man konnte über den Inneren Ring sagen, was man wollte – dass es hier genauso stank wie in allen anderen Teilen der Kanalisation, dass die Untoten keinen Deut freundlicher waren, und dass man die Stadt der lebenden Toten sowieso besser nie betrat – aber ich fühlte mich hier, wo jeder Winkel von Fackeln ausgeleuchtet war und zu jeder Zeit geschäftiges Stimmengewirr herrschte, rundum wohl. Ich wusste zwar, wie naiv es war, aber es fühlte sich so an, als wäre man hier sicher.
Die unterste Ebene war die schäbigste der drei, welche den Inneren Ring bildeten. Dennoch gab es hier unten ein Plateau mit hervorragender Aussicht auf die grünen, schleimigen Fluten, die sich durch Undercity wandten, und hier wurden auch die hervorragendsten Pilzgerichte gekocht, die man in Undercity bekommen konnte. Jedes Mal, wenn ich an den offenen Feuerstellen vorbei lief und den vom Rauch geschwängerten Inhalt der bauchigen, riesigen Kesseln roch, lechzte es in mir nach einer Schüssel des Pilzragouts, das dort vor sich hin köchelte. Inzwischen hatte ich jedoch auch eingesehen, dass ich in meinem Zustand nur noch bedingt Hunger, Durst und Müdigkeit verspürte. Ich konnte den Begriffen etwas zuordnen; aber sie fühlten sich leer an, wie aus einem anderen Leben, und nicht so bedeutend, wie sie sein sollten. Dennoch gab ich nur zu gerne den Verlockungen nach.
Ich ging an dem sabbernden Untoten vorbei, der versuchte, dressierte, daumengroße Schaben zu verkaufen, und erklomm die Treppe zur mittleren Ebene. Dort stand, alleine und schon deshalb geradezu erhaben, das Bankhaus von Undercity.
Meine Laune erhielt doch noch einen entschiedenen Dämpfer, als mir bewusst wurde, was mir bevor stand.
Ich straffte meine Schultern, nestelte ein wenig an meiner zerrissenen Hose herum und versuchte, möglichst einschüchternd zu wirken, als ich auf eines der Gitterfenster zuging. Noch ehe ich dort angekommen war, konnte ich schon sehen, dass ich erwartet wurde: Die geisterhafte Dame mit dem zum Leben erwachten Haar grinste mich breit an. »Na, mein Kleiner? Hast du etwas verloren?«
»Einen Lederbeutel voller Münzen, um genau zu sein«, erwiderte ich mürrisch. Ich hoffte inständig, dass sie mich nicht wieder mit ihren Haaren packen würde. »Ich brauche mein Geld wieder.«
Als hätte sie nur darauf gewartet, schlängelte sich eine ihrer weißen Haarsträhnen durch die Gitterstäbe. Sie hielt den Lederbeutel fest umschlungen, ließ ihn aber umstandslos in meine offene Hand fallen.
Auch wenn ich mir vorgenommen hatte, sie nicht leiden zu können, konnte ich mir ein Lächeln doch nicht verkneifen. »Ihr scheint Euren Beruf wohl gelernt zu haben, Milady.«
Der Geist starrte mich an, als stände ein lebender Mensch vor ihr. Für einige Augenblicke und mit steigender Panik glaubte ich, etwas gesagt zu haben, das ich gleich bereuen würde; doch stattdessen entspannten sich die Züge der Dame wieder. Sie erwiderte sogar mein Lächeln, und es gab ihr einen sehr hübschen Eindruck, sah man davon ab, dass man die Steine der gegenüberliegenden Wand durch sie hindurch sehen konnte.
»Sicher, dass du ein Untoter bist, Kleiner?«
Ihre Frage überraschte mich so sehr, dass ich nicht so recht wusste, wie ich darauf antworten sollte. Ein Blick auf meine Hände entpuppte sich als äußerst hilfreich, wenn man bedachte, dass meine Fingerspitzen von Ratten angenagt worden waren und die Knochen blank lagen. Ich hielt sie hoch, wackelte ein wenig mit den Fingern und erwiderte: »Ich glaube nicht, dass es daran irgendwelche Zweifel gibt.«
Sie kicherte. Die geisterhafte Dame kicherte wie ein kleines Mädchen, und sie war das erste Wesen in Undercity, dessen Lachen sich nicht falsch oder schadenfroh, sondern ehrlich anhörte. Als ihr mein verwirrter Blick auffiel, zwinkerte sie mir zu. »Ich habe meine Zweifel.«
»Und warum das?«
Mit den Ellenbogen auf dem Fenstersims, stützte sie ihren Kopf in ihren Händen und sah mich belustigt an. »Du wärst der erste Untote, dessen Humor nicht grausam ist und der auch noch freundliche Worte formulieren kann.«
Eine meiner Augenbrauen hob sich wie von selbst. »Ich kann nicht der einzige Untote sein, der freundlich ist. In– eine Weggefährtin von mir ist ebenfalls sehr freundlich, und sie ist untot.«
»Dann muss sie etwas Besonderes sein, genau so wie du.«
»Und was, wenn Ihr die Untoten nur falsch einschätzt? Ihr seid doch selbst untot, oder nicht?«
Der Geist lächelte auf meine Frage hin versonnen. »Es gibt Geister, und es gibt Untote. Geister entstehen durch eine enge Bindung an etwas, das wir zurücklassen mussten. Wir sehnen uns so sehr danach, dass wir zu den Lebenden zurückkehren. Aber Untote, so wie du? Ihr werdet von der Seuche wiederbelebt, die Arthas in das Land geschleppt hat. Ihr ward Menschen; jetzt seid ihr Monster mit einem letzten Rest Willen, um selbst zu bestimmen, wen ihr tötet. Und ihr tötet alles, was lebendig ist, weil ihr es hasst, und die Lebenden hassen euch dafür, und für das, was ihr seid.«
Ich starrte die Frau an. Sie sagte die Worte voller Überzeugung, so sehr, dass es fast schon angsteinflößend war.
»Warum also, mein lieber Freund, schaffst du es, freundliche Worte zu formulieren, obwohl du die Gabe dafür hättest verlieren sollen? Warum schaffst du es zu lächeln, obwohl du keinen geschändeten Leichnam vor dir liegen siehst oder eine Leiche, über die du selbst im nächsten Moment herfallen kannst? Warum beäugst du nicht hasserfüllt die wenigen Lebenden, die sich überhaupt noch in unsere Stadt trauen?«
Hilflos hob ich meine Hände und zuckte nur mit den Schultern. »Ich weiß nicht. Warum sollte ich die Lebenden hassen? Sie haben mir nichts getan.«
Die Augen der Dame wurden mit einem Mal hart wie Granit. »Die Lebenden verabscheuen uns. Sie würden uns lieber unter der Erde sehen als auf ihr wandelnd. Sie fürchten uns.«
»Ihr hasst sie deswegen doch auch nicht, oder?«, fragte ich zögerlich.
Ihre schemenhaften Lippen formten ein schmales Lächeln. »Ich lebe zu lange, um ewig einen Groll gegen sie zu hegen. Und es wäre zudem schlecht für das Geschäft. Aber ich bin auch ein Geist.«
»Und Geister sind keine Untoten«, führte ich den Gedanken laut zu Ende.
»Du bist der Bursche, der für Direflesh arbeitet, nicht wahr?«
Ich nickte nur stumm, während ich den Lederbeutel einsteckte. Beinahe fiel er durch ein Loch in meiner Hosentasche wieder heraus, und ich musste ihn auf der anderen Seite einpacken. Ich nahm mir noch im selben Moment vor, als erstes anständige Kleider zu kaufen, und einen Gürtel, an dem ich den Beutel festmachen würde.
»Er gehört zum grausamsten Abschaum in unserer Stadt. Lass dich nicht von ihm täuschen. Er mag verwirrt und verrückt wirken, aber er ist das genaue Gegenteil. Bleibe in seiner Gunst, solange du kannst, und verschwinde, sobald es dir möglich ist.«
Ich blickte die Frau ein letztes Mal an, nickte wieder und wandte mich dann von ihr ab. Meine Füße liefen wie von selbst die Stufen zur nächsten Ebene hinauf, während meine Gedanken noch um das Gespräch kreisten. Niemand gab mir eine Chance, noch lange unter ihnen zu weilen. Ich hatte bereits am eigenen Leib erfahren, wie impulsiv Direflesh sein konnte; trotzdem sah es nicht so aus, als würde er in nächster Zeit auf meine Dienste verzichten wollen. Aber womöglich hatte die geisterhafte Dame ja Recht, und er brauchte mich nur noch für eine kurze Zeit. Zum Beispiel so lange, bis er die letzte Zutat für seinen Todestrunk gefunden hatte.
Mir wurde allmählich unwohl, während ich darüber grübelte. Seufzend beschloss ich, mich später damit zu befassen und zuerst einmal ein wenig in meinen Büchern zu schmökern. Als ich aufsah, stellte ich verblüfft fest, dass mich meine Füße direkt zu der heruntergekommenen, viel zu engen Taverne geführt hatten, die mir Inessa gezeigt hatte. Nur zu gerne nahm ich an einem der leeren Tische Platz und nickte dem dürren Wirt zu. Er musste nicht einmal fragen, um zu wissen, was ich wollte, und noch bevor ich mein Buch – jenes über Nekromantie – ausgepackt und vor mir hingelegt hatte, stand bereits ein Krug mit der übel riechenden Flüssigkeit daneben.
Ich kramte rasch meinen Lederbeutel hervor, hielt dann aber kurz inne. Mit einem finsteren Blick und eiserner Miene starrte ich dem Untoten mitten in die Augen, der noch immer neben mir stand und mir seine geöffnete Hand entgegen streckte. »Du weißt, für wen ich arbeite.«
Ein hämisches Grinsen entblößte etliche Lücken zwischen seinen Zähnen, als er antwortete: »Deshalb kassiere ich dich auch gleich ab.«
Ich konnte spüren, wie sich meine Augen zu Schlitzen verengten. Als das Grinsen bestehen blieb, seufzte ich innerlich auf, schnürte aber scheinbar unberührt den Lederbeutel auf und zählte dem Wirt fünf Kupfermünzen in seine Hand ab. »Das sollte für die nächsten Runden reichen.«
Mein Gegenüber grunzte nur zufrieden und verzog sich wieder hinter seine Theke, wo er begann, mit einem schmutzigen Lappen schmutzige Krüge noch schmutziger zu machen.
Ich schlug das Buch auf und blätterte ein wenig durch die Seiten. Der Ledereinband knirschte dabei leise. Obwohl sich bestimmt niemand außer Direflesh selbst in seine Bibliothek verirrte, waren die Bücher zu einem großen Teil in einem erbärmlichen Zustand. Die wenigen, die ich eingepackt hatte, wiesen Risse auf, ihnen fehlten Seiten oder sie waren von Flüssigkeiten benetzt worden, die Löcher in das Pergament gebrannt und die Buchstaben ausgelöscht hatten. Ihr Besitzer ging nicht eben zimperlich mit ihnen um, und das Ausmaß der Zerstörung jagte mir immer wieder einen Schauer über den Rücken, wenn ich Zeuge davon wurde.
Nach kurzer Suche fand ich den Schattenblitz. Schlussendlich war es eine schwarze Kugel aus Magie, die alles auffraß, was sich ihr in den Weg stellte. Sie missachtete herkömmliche Rüstungen und brannte sich in das Fleisch des Unglücklichen, um es zu verzehren. Es schien kein schwerer Zauber zu sein, aber dennoch war er mächtig genug, um den Feind töten zu können. Einige der Illustrationen zeigten Leichen, in deren Brust etwa faustgroße Löcher klafften oder denen Gliedmaßen fehlten. Die Stümpfe sahen aus, als hätte man sie ihnen weggerissen.
Auch wenn das alles grausame Darstellungen waren und sie mir nicht gerade gefielen, faszinierten sie mich umso mehr, da sie so zerstörerisch waren. Wenn ich den Schattenblitz beherrschen würde, hätte ich mich bereits einigen Anweisungen Direfleshs mit Leichtigkeit widersetzen können. Zumindest war das etwas, worüber ich gerne und ausgiebig nachdachte.
Aber ich wusste nicht einmal, ob ich überhaupt dafür geschaffen war, Zauber zu weben. Ich konnte nicht sagen, welche Voraussetzungen man dafür benötigte, noch, ob ich sie besaß. Zwar schwirrte mir immer wieder der Zwischenfall mit dem Zombie im Wald durch den Kopf – das blaue Licht, das erstrahlt war, und der leblose Leichnam, der daraufhin neben mir gelegen hatte – aber ich wusste nicht, was das bedeuten zu bedeuten hatte. In jedem Fall konnte ich nicht auf Hilfe von Direflesh bauen, wenn ich mir irgendwelche magischen Künste beibringen wollte. Ich konnte höchstens versuchen, möglichst viel Wissen zu sammeln und es dann irgendwie anzuwenden.
Ich strich mir nachdenklich über das Kinn, während ich die Seiten ein ums andere Mal durchlas. Es klang alles so einfach, dass ich für einige Augenblicke meine Hand betrachtete, dann wieder die Zeichnung in dem Buch, dann meine Finger genau so wie dort gezeigt verbog. Ich atmete so tief aus, dass ich keine Luft mehr in meinen Lungen zu haben schien; in diesem Zustand konnte ich mich am besten konzentrieren.
So leise, dass es auch der Wirt nicht hören konnte, wisperte ich die fremd anmutenden Worte, die im Buch standen, und ließ zugleich meine Hand nicht aus den Augen.
Als ich das letzte Wort gesprochen hatte, spürte ich ein angenehmes Kitzeln in meinen Fingerspitzen. Aufgeregt wartete ich darauf, dass sich die schwarze Kugel zwischen ihnen bilden, sie wachsen und dann mit atemberaubender Geschwindigkeit hinfort fliegen würde.
Aber nichts geschah.
Enttäuschung machte sich in mir breit. Trotzig wiederholte ich die Worte noch einmal, aber wieder passierte nichts, und auch das Kitzeln blieb aus. Der Gedanke, dass ich es mir nur eingebildet hatte, wurde so unerträglich laut, dass ich mit der eben noch ausgestreckten Hand unwirsch meinen Krug krallte und den Inhalt in einem Zug in mich hinein goss. Murrend und über den Seiten brütend wartete ich darauf, dass der Wirt ihn füllte, und kaum dass das Lagerbier wieder darin herum schwappte, setzte ich den Krug von neuem an und leerte ihn bis zur Hälfte.
Wahrscheinlich war ich eben doch kein Magier, und das blaue Licht hatte ich mir am Ende auch nur eingebildet. Vielleicht war der Zombie einfach so tot umgefallen. Womöglich war seine Zeit abgelaufen, und was ihn zum Leben erweckt hatte, hatte ihn in genau dem Moment verlassen, als er mir in meine Nase hatte beißen wollen.
Ich verbrachte noch ein wenig Zeit damit, einige Seiten des Nekromanten-Buchs zu studieren, mir Wörter und Bewegungen zu merken. Auch wenn es nicht viel Sinn machte, hinterließ es ein gewisses Gefühl der Sicherheit, oder zumindest des Trotzes; ich tat etwas, das mir vielleicht einmal helfen würde. Wenn nicht, dann hatte ich meine Zeit zumindest mit etwas Interessantem verbracht.
Als ich den Krug vollends leerte, packte ich das Buch wieder in meine Ledertasche und machte mich auf. Ich musste nicht lange suchen, um einen Laden zu finden, der Kleidung verkaufte: Stoffroben waren in Undercity hoch im Kurs. Wie schon in Brill zuvor schien auch hier jeder, der Wert auf sich legte, eine reich verzierte Robe zu tragen, um seiner Position Ausdruck zu verleihen. Ich konnte all dem Gehabe nicht viel abgewinnen, aber außer Roben schien es praktisch nichts anderes zu geben. Als ich einen der untoten Schneider auf einfache Hosen und Hemden ansprach, lachte dieser mich aus. »Geh raus und grab einen von den Toten aus, wenn du solchen Tand willst!«, zwitscherte er mir noch hinterher, als ich ihm mit finsterer Miene den Rücken zukehrte und weiter suchte.
Tatsächlich hatten die wenigsten Schneider herkömmliche Kleidung im Angebot. Die meisten hatten sich auf Magierroben spezialisiert, wie mir eine überaus hässliche, aber zumindest nur unfreundliche Schneiderin erzählte. »Wir weben Zauber ein, machen sie robust gegen die Elemente, versuchen manchmal auch, sie gegen Schwerter und Äxte zu wappnen.« Als sie mir einen Blick zuwarf, schüttelte sie aber nur den Kopf. »Du bist kein Magier, und du könntest dir eine Robe nicht mal leisten, also verschwinde.«
Meine Suche endete erst bei einem Händler, der mir überaus dreckige, aber immerhin intakte Klamotten für einen unverschämt hohen Preis überließ. »Nicht die beste Qualität«, gab er grinsend zu, »aber vermutlich die einzigen Hosen, die man in ganz Undercity findet.«
»Sie sehen aus wie frisch aus dem Grab geklaut«, gab ich verärgert zurück, als ich aus der engen Umkleidekabine heraus trat, die hinter dem Stand aufgebaut worden war.
»Was glaubst du, warum sie so teuer sind?«, erwiderte der Verkäufer mit einem bösartigen Lachen.
Meine Hände hätten sich schon längst an die Kehle des kleinen Bastards gekrallt und sie heraus gerissen, wenn ich sie nicht mühsam unter Kontrolle gehalten hätte. Als er die Hand aufhielt und auf die Silbermünze wartete, die er für ein paar zusammen geschneiderte Leinen verlangte, betrachtete ich ihn mit einem möglichst vernichtenden Blick. »Ich bin der Gehilfe von Direflesh.«
Die Hand schloss sich für einen Moment, als der Händler erschrocken in meine Augen blickte; einen Moment später wurde seine Miene grimmig, und seine Hand öffnete sich wieder. »Wir hatten einen Preis vereinbart. Zahl ihn.«
Inessa kam mir wieder in den Sinn. Sie verstellte sich, um zu überleben.
Jetzt war wohl die Zeit gekommen, um herauszufinden, ob ich es ihr gleichtun konnte.
Meine linke Hand stieß nach vorne und packte den Untoten am Hals. Er war fast ein Kopf kleiner als ich und dürr wie ein wandelndes Gerippe; ich musste mich nicht einmal sonderlich anstrengen, um ihn nach oben zu heben. Einige panische Laute drangen aus seinem Mund hervor, verebbten jedoch sofort, als ich meinen Griff ein wenig verstärkte.
»Ich denke, du weißt, was ein Schattenblitz ist? Nick einfach.«
Sein Versuch misslang kläglich, aber dennoch war die Kröte eindeutig darum bemüht zu nicken. Seine Augen, die ohnehin schon weit aufgerissen waren, quollen geradezu hervor, als sie meine rechte Hand einige filigrane Bewegungen ausführen sahen und er die Formel für den Zauber vernahm. Mit seinen Fingern kratzte er von meinem Arm die Haut ab, ohne dass ich mich darum geschert hätte.
Beim letzten Wort verharrte ich für einen Moment. Der Händler hatte die Augen bereits geschlossen und blinzelte dann zögerlich, als das erwartete Ende doch nicht eintrat.
Ich rümpfte meine Nase in gespielter Verachtung und schmiss den Untoten dann einfach über seine Ladentheke hinweg. Er fegte dabei einige seiner Kleider vom Tisch herunter und landete mit ihnen im Dreck.
Um mich herum war es sehr still geworden. Als ich kurz über meine Schulter sah, konnte ich viele Untote sehen, die mich ausdruckslos ansahen. Die wenigen lebenden Wesen, die zwischen ihnen standen, betrachteten mich hingegen weniger leidenschaftslos: Ihre Gesichter spiegelten Hass und teilweise, wenn auch eher versteckt, Furcht wieder.
Dann, unter einigem Stöhnen und Grunzen, bahnte sich eine Monstrosität ihren Weg durch die Menge wie ein Riese durch eine Herde von Schafen. Die meisten der Schaulustigen waren schlau genug, dem Leichenberg auszuweichen, doch ein Untoter hatte ihn wohl zu spät bemerkt. Einen Moment später segelte er, von einer der mächtigen Fäuste getroffen, durch die Luft und landete weiter unten schreiend in den grünen Fluten von Undercity.
Eine noch immer panisch quietschende Stimme hinter mir schrie sofort: »Töte diesen Madenfresser! Töte ihn, augenblicklich!«
Ein einziger Blick genügte, um den Händler zum Schweigen zu bringen. Ich schaffte es tatsächlich noch immer, meine Maskerade aufrecht zu erhalten, auch wenn es inzwischen eher Verzweiflung war, die mir Kraft gab, anstatt wie vorher noch die berauschende Wirkung von Macht. Die Monstrosität kam direkt auf mich zu und blieb nur einen Schritt von mit entfernt stehen.
Als ich aufblickte und in das unförmige Gesicht sah, hätte ich fast zu lachen begonnen. Ich ließ mich schließlich zu einem schmalen Lächeln hinreißen, das Gordo zwar nicht mit seinem unförmigen, geöffneten Mund erwiderte, wohl aber mit seinen kleinen Augen. Wir mussten nicht einmal Worte wechseln, um uns zu verständigen.
Ich drehte mich noch einmal zu dem Händler um, als mir ein schlichter, schwarzer Umhang auffiel, der das Chaos unversehrt überlebt hatte und noch immer an seinem Haken hing. Ich nahm ihn herunter, warf ihn mir um die Schulter und schloss die Schnalle, um mir dann die angenähte Kapuze über den Kopf zu ziehen. Gordo war währenddessen bereits weiter marschiert und pflügte auf der anderen Seite durch die verblüffte Menge hindurch. Selbst die Verlassenen, die meinen kleinen Kampf beobachtet hatten, schauten der Monstrosität verwundert nach.
Als ich auf sie zuging, bildete sich rasch eine Gasse. Bei jedem meiner Schritte hörte ich gewisperte Worte und getuschelte Gespräche. Ich konnte die Blicke der Untoten und der Lebenden auf mich spüren, und in den Bruchteilen einer Sekunde beschloss ich, ihnen mit Schweigen und Verschlossenheit zu begegnen. Unbeteiligt, ohne meine Schritte zu verlangsamen oder jemanden eines Blickes zu würdigen, ging ich die Straße entlang und folgte ihr, bis ich endlich aus der Menge heraus trat. Dann bahnte ich mir einen Weg in die äußeren Viertel der Stadt.
Erst, als ich mich in einem der dunklen Gänge zwischen den größeren Arealen Undercitys befand, wagte ich es, stehen zu bleiben und mich umzusehen. Einige waren mir gefolgt, dessen war ich gewiss, aber ich musste sie inzwischen abgeschüttelt haben. Niemand war zu sehen, und was noch viel wichtiger war: niemand hatte mich aufgehalten.
Ich betrachtete fassungslos meine Hände. An meinem Arm hingen noch kleine Stücke der Haut weg, die der Händler aufgekratzt hatte, stumme Zeugen des Kampfes. Ich spürte, wenn auch nur schwach, den Stoff auf meiner Haut, und ein Gefühl, das mich von innen her auffraß.
Ich lachte. Ich lachte so laut, dass es sich in dem engen Gang anhörte, als würden hunderte verrückte Leute mit krächzender Stimme gemeinsam lachen.
Und während ich lachte, wurde mir klar, dass ich ab sofort etwas war, das ich nicht sein wollte.
Die Formatierung zerhaut mir übrigens gerade wieder meinen Text... mit Lücken zwischen jedem Absatz wird's immerhin ein wenig übersichtlicher. Bitte denkt nicht, dass ich das nur mache, um es wie mehr aussehen zu lassen, als es tatsächlich ist. Ich bin schlichtweg zu faul, all die Absätze wieder herauszulöschen, wenn das copy-paste immerhin schon so schön übersichtlich aufgedröselt wird.
PS.: Wenn ihr "plot holes" findet, sagt bitte umgehend Bescheid! Keine Lust, mich wieder im selben Mist zu verfangen wie das letzte Mal...
_____
Kapitel 8 – Eine neue Haut
Die nächsten Stunden vergingen wie im Flug. Ich konnte nicht einmal genau sagen, wie viele Tage sie bildeten, weil Undercity komplett von der Sonne abgeschnitten war. Ich zählte stattdessen Fackeln, die abbrannten, und Kohlepfannen, die aufgefüllt werden mussten. Fünf Fackeln waren schon zu kleinen Stümpfen verkommen und ausgetauscht worden seit meinem Ausflug ins Schurkenviertel.
Inessa hatte ich seitdem nicht wieder gesehen. Ohnehin hätte ich keine Zeit gehabt, mich mit ihr zu unterhalten: Direflesh hielt mich erbarmungslos auf Trab, verlangte Kräuter, die man nur in den hintersten Winkeln von Undercity finden konnte, forderte Eingeweide und Gedärme von Tieren, die beinahe ausgerottet waren, und ließ sich alles von mir liefern, ohne auch nur ein einziges Mal Dank zu zeigen. Zu allem Überfluss hatte er es sich auch noch in den Kopf gesetzt, mich stets mit einigen Flammenbällen zu begrüßen. Wahrscheinlich hoffte er, dass ich einmal zu spät ausweichen und mit einem Schlag verbrennen würde; zumindest seine Augen glitzerten stets mordlüsternd, wenn er mich ansah. Nach der ersten Attacke, der ich nur mit viel Glück entronnen war, lernte ich sehr schnell, mich ihm leise zu nähern und nicht allzu lange in seiner Nähe zu verweilen.
Doch so sehr ich das alte Gerippe verabscheute, musste ich dennoch zugeben, dass ich einige kleine Vorzüge genoss, seitdem ich ihm zwangsweise als Laufbursche diente. Zum einen war Direflesh eine stadtbekannte Figur; es genügte vollends, seinen Namen auszusprechen, und Gespräche verstummten. Die meisten der Untoten, die mitbekamen, dass ich für ihn arbeitete, bedachten mich mit einem hämischen Blick. Die wenigsten schienen damit zu rechnen, dass ich den nächsten Sonnenumlauf überleben würde. Andere, vor allem die wenigen Tauren, die ich zu Gesicht bekam, schienen dagegen regelrecht Mitleid mit mir zu haben. Wirte und Schankmeister gaben mir jedenfalls umsonst zu trinken, was ich wollte, entweder aus Mitleid oder aus Furcht. Ich genoss es, solange ich konnte.
Außerdem hatte ich Eintritt in das Refugium des Apothekers erhalten. Wenn man durch die Tür trat, fiel zuerst das bläuliche Netz auf, welches sich kaum sichtbar über den Eingang spannte. Direflesh hatte es mir gegenüber nur ein Mal erwähnt. Es schien all jene in kleine Würfel zu schneiden, die ohne seine Erlaubnis Zugang zu seinem Haus suchten. Von dem Netz abgesehen, glomm in jeder noch so winzigen Ecke des Hauses ein Zauber, von denen die meisten wohl zerstörerischer Natur waren. Nur die helle Lichtkugel, die an der Decke schwirrte und dem alten Griesgram auf Schritt und Tritt folgte, machte einen einigermaßen freundlichen Eindruck.
Das Haus, welches lediglich aus einem verlies-artigen Zimmer bestand, war spartanisch und nutzbringend eingerichtet. Es war praktisch leer, mit Ausnahme einiger gläserner Geräte und Röhrchen, einer Feuerstelle, über der ein rostiger und kaum gebrauchter Kessel hing, und einem riesigen Regal, in welchem Direflesh all das aufbewahrte, was ich ihm brachte. Süßlicher Verwesungsgestank erfüllte stets die Luft, ab und zu geschwängert von dem betörenden Duft fremder Kräuter. Direflesh schien nie zu schlafen, denn er hatte es nicht für nötig gehalten, ein Bett aufzustellen. Dafür führte eine verrottendeTür, die in dem großen Raum ein wenig falsch am Platz wirkte, in eine winzige Kammer, vollgestopft mit Büchern in fremden Sprachen und Sprachen, die ich sogar verstand. Einige dieser Bücher, die ich für interessanter hielt als die anderen, hatte ich kurzerhand eingesteckt, und jedes Mal, wenn ich mir eine kleine Pause zwischen meinen ewigen Botengängen leisten konnte, schmökerte ich in ihnen herum.
Eines hatte es mir besonders angetan. Es befasste sich mit der Kunst der Magie, vor allem der schwarzen Beschwörungsformeln. Schattenblitze waren illustriert dargestellt, mitsamt aller Wörter, die für den Zauber nötig waren, und den dazugehörigen Handbewegungen. Weiter hinten tauchten andere, nützliche Sprüche auf: etwa die Dämonenhaut, welche am ehesten einer magischen Rüstung ähnelte; oder die Beschwörung eines Leerwandlers, welcher den Befehlen seines Herren bedingungslos folgte und für ihn sogar bis zum Tod kämpfte. Gerade der Leerwandler weckte mein Interesse. Er hätte sich um meine Arbeiten kümmern können, während ich das Buch weiter gelesen hätte. Dummerweise verstand ich praktisch nichts von Magie und Beschwörungen, und obwohl ich danach stöberte, konnte ich in Direfleshs Bibliothek kein Buch finden, das mir die grundlegenden Dinge erklärt hätte.
Immer wieder war ich versucht, meinen neuen Meister einmal darauf anzusprechen. Aber jedes Mal hielt mich meine Furcht, ihm auch nur einen Schritt näher zu kommen als unbedingt notwendig, zurück.
Gerade stand ich wieder einmal vor dem Arbeitstisch des Untoten. Was auch immer er braute, es stank scheußlich nach Schwefel, Verfall und Tod. Angesichts dessen, was ich bisher schon im Apothekarium zu Gesicht bekommen hatte, ging ich davon aus, dass Direflesh besonders bösartige Experimente durchführen musste. Solange er jedoch nicht vorhatte, mir etwas von seiner Braukunst verabreichen zu wollen, war es mir ziemlich gleichgültig. Ich legte die kleine Phiole mit Gift, die er von mir verlangt hatte, neben den Überresten irgendwelcher grünlich schimmernden Gedärme, und ging dann rasch zur Tür hinüber.
Direflesh selbst schien sich in seiner Bibliothek aufzuhalten: Licht strahlte aus dem kleinen Raum und der halb geöffneten Tür hervor, und ich konnte hören, wie er achtlos einige seiner Bücher zu Boden warf. Ein Grunzen, dem eines zufriedenen Schweines nicht unähnlich, folgte, und der Apotheker trat wieder in sein Labor, wo er mich an der Pforte zur Freiheit stehend entdeckte. »Ah, du bist schon wieder zurück gekehrt. Tüchtig, tüchtig, der kleine Streuner…«
Er bleckte seine gelben Zähne und eilte zu seinem Tisch hinüber, wo er die Phiole zur Hand und die glasklare Flüssigkeit darin genauer in Augenschein nahm. »Das reine Gift einer Königskobra… was noch? Was könnte noch fehlen?«, murmelte er leise vor sich hin.
Ich beobachtete ihn genau. Direflesh hatte die Angewohnheit, reizbar zu werden, wenn er länger überlegen musste. Seine Wut ließ er gerne an den Wänden seines Hauses aus – die meisten der Steine waren schwarz verbrannt, als hätten unzählige Feuer an ihnen geleckt – und seit neuestem auch an mir.
Als er sich wieder an mich wandte, machte er zu meiner unendlichen Erleichterung einen ruhigen Eindruck, solange man einen Wahnsinnigen ruhig nennen konnte. »Ich muss nachdenken… und du störst mich dabei!«, brüllte er mich plötzlich an. Während ich noch erschrocken zusammen zuckte, hatte meine Hand bereits die Türklinke gefunden und nach unten gedrückt. Der Feuerball zischte über meinen Kopf hinweg, als ich mich hastig duckte, und durch die inzwischen offene Tür hinaus in das Apothekarium. Schreie und Rufe, nicht minder erschrocken wie ich, ertönten, bis das Klirren und Bersten von Glas zu vernehmen war.
»Raus! Verschwinde, und komm nicht vor morgen wieder, oder ich reiße dir deinen Kopf ab!«
Meine Augen wurden groß, als die Worte aus Direflehs Mund an meine Ohren drangen. »Natürlich, Meister!«, erwiderte ich ein wenig zu schnell, um meine Freude verbergen zu können. Einen Moment später rannte ich bereits durch den schlecht beleuchteten Gang in Richtung Äußeren Rings. Die Umhängetasche, die ich inzwischen erstanden hatte, um meine Bücher darin aufzubewahren, hüpfte auf und ab und brachte mich fast aus dem Gleichgewicht, aber ich war zu sehr damit beschäftigt, wenigstens für kurze Zeit aus Direfleshs eisernen Griff zu entfliehen, um darauf zu achten.
Erst, als ich das Apothekarium mit seinen finsteren Kammern und noch finstereren Bewohnern hinter mir gelassen hatte und wieder vor dem giftgrünen Kanal stand, zwang ich mich, stehen zu bleiben. Es benötigte einiges an Willenskraft, nicht in lauter Jubel auszubrechen und Luftsprünge zu machen; stattdessen folgte ich eilig und mit einem breiten Grinsen im Gesicht dem Fluss, bis ich eine der unzähligen und schlecht gewarteten Brücken fand und auf die andere Seite übersetzte. Nicht einmal die Leere der Katakomben Lordaerons konnte mir meine gute Laune nehmen, während ich meinen Weg fortsetzte.
Es dauerte nicht lange, bis ich die allmählich auftauchenden Giftmischereien und Geschäfte voller Halsabschneider hinter mir gelassen und in den gehobeneren Bereich Undercitys eingedrungen war. Man konnte über den Inneren Ring sagen, was man wollte – dass es hier genauso stank wie in allen anderen Teilen der Kanalisation, dass die Untoten keinen Deut freundlicher waren, und dass man die Stadt der lebenden Toten sowieso besser nie betrat – aber ich fühlte mich hier, wo jeder Winkel von Fackeln ausgeleuchtet war und zu jeder Zeit geschäftiges Stimmengewirr herrschte, rundum wohl. Ich wusste zwar, wie naiv es war, aber es fühlte sich so an, als wäre man hier sicher.
Die unterste Ebene war die schäbigste der drei, welche den Inneren Ring bildeten. Dennoch gab es hier unten ein Plateau mit hervorragender Aussicht auf die grünen, schleimigen Fluten, die sich durch Undercity wandten, und hier wurden auch die hervorragendsten Pilzgerichte gekocht, die man in Undercity bekommen konnte. Jedes Mal, wenn ich an den offenen Feuerstellen vorbei lief und den vom Rauch geschwängerten Inhalt der bauchigen, riesigen Kesseln roch, lechzte es in mir nach einer Schüssel des Pilzragouts, das dort vor sich hin köchelte. Inzwischen hatte ich jedoch auch eingesehen, dass ich in meinem Zustand nur noch bedingt Hunger, Durst und Müdigkeit verspürte. Ich konnte den Begriffen etwas zuordnen; aber sie fühlten sich leer an, wie aus einem anderen Leben, und nicht so bedeutend, wie sie sein sollten. Dennoch gab ich nur zu gerne den Verlockungen nach.
Ich ging an dem sabbernden Untoten vorbei, der versuchte, dressierte, daumengroße Schaben zu verkaufen, und erklomm die Treppe zur mittleren Ebene. Dort stand, alleine und schon deshalb geradezu erhaben, das Bankhaus von Undercity.
Meine Laune erhielt doch noch einen entschiedenen Dämpfer, als mir bewusst wurde, was mir bevor stand.
Ich straffte meine Schultern, nestelte ein wenig an meiner zerrissenen Hose herum und versuchte, möglichst einschüchternd zu wirken, als ich auf eines der Gitterfenster zuging. Noch ehe ich dort angekommen war, konnte ich schon sehen, dass ich erwartet wurde: Die geisterhafte Dame mit dem zum Leben erwachten Haar grinste mich breit an. »Na, mein Kleiner? Hast du etwas verloren?«
»Einen Lederbeutel voller Münzen, um genau zu sein«, erwiderte ich mürrisch. Ich hoffte inständig, dass sie mich nicht wieder mit ihren Haaren packen würde. »Ich brauche mein Geld wieder.«
Als hätte sie nur darauf gewartet, schlängelte sich eine ihrer weißen Haarsträhnen durch die Gitterstäbe. Sie hielt den Lederbeutel fest umschlungen, ließ ihn aber umstandslos in meine offene Hand fallen.
Auch wenn ich mir vorgenommen hatte, sie nicht leiden zu können, konnte ich mir ein Lächeln doch nicht verkneifen. »Ihr scheint Euren Beruf wohl gelernt zu haben, Milady.«
Der Geist starrte mich an, als stände ein lebender Mensch vor ihr. Für einige Augenblicke und mit steigender Panik glaubte ich, etwas gesagt zu haben, das ich gleich bereuen würde; doch stattdessen entspannten sich die Züge der Dame wieder. Sie erwiderte sogar mein Lächeln, und es gab ihr einen sehr hübschen Eindruck, sah man davon ab, dass man die Steine der gegenüberliegenden Wand durch sie hindurch sehen konnte.
»Sicher, dass du ein Untoter bist, Kleiner?«
Ihre Frage überraschte mich so sehr, dass ich nicht so recht wusste, wie ich darauf antworten sollte. Ein Blick auf meine Hände entpuppte sich als äußerst hilfreich, wenn man bedachte, dass meine Fingerspitzen von Ratten angenagt worden waren und die Knochen blank lagen. Ich hielt sie hoch, wackelte ein wenig mit den Fingern und erwiderte: »Ich glaube nicht, dass es daran irgendwelche Zweifel gibt.«
Sie kicherte. Die geisterhafte Dame kicherte wie ein kleines Mädchen, und sie war das erste Wesen in Undercity, dessen Lachen sich nicht falsch oder schadenfroh, sondern ehrlich anhörte. Als ihr mein verwirrter Blick auffiel, zwinkerte sie mir zu. »Ich habe meine Zweifel.«
»Und warum das?«
Mit den Ellenbogen auf dem Fenstersims, stützte sie ihren Kopf in ihren Händen und sah mich belustigt an. »Du wärst der erste Untote, dessen Humor nicht grausam ist und der auch noch freundliche Worte formulieren kann.«
Eine meiner Augenbrauen hob sich wie von selbst. »Ich kann nicht der einzige Untote sein, der freundlich ist. In– eine Weggefährtin von mir ist ebenfalls sehr freundlich, und sie ist untot.«
»Dann muss sie etwas Besonderes sein, genau so wie du.«
»Und was, wenn Ihr die Untoten nur falsch einschätzt? Ihr seid doch selbst untot, oder nicht?«
Der Geist lächelte auf meine Frage hin versonnen. »Es gibt Geister, und es gibt Untote. Geister entstehen durch eine enge Bindung an etwas, das wir zurücklassen mussten. Wir sehnen uns so sehr danach, dass wir zu den Lebenden zurückkehren. Aber Untote, so wie du? Ihr werdet von der Seuche wiederbelebt, die Arthas in das Land geschleppt hat. Ihr ward Menschen; jetzt seid ihr Monster mit einem letzten Rest Willen, um selbst zu bestimmen, wen ihr tötet. Und ihr tötet alles, was lebendig ist, weil ihr es hasst, und die Lebenden hassen euch dafür, und für das, was ihr seid.«
Ich starrte die Frau an. Sie sagte die Worte voller Überzeugung, so sehr, dass es fast schon angsteinflößend war.
»Warum also, mein lieber Freund, schaffst du es, freundliche Worte zu formulieren, obwohl du die Gabe dafür hättest verlieren sollen? Warum schaffst du es zu lächeln, obwohl du keinen geschändeten Leichnam vor dir liegen siehst oder eine Leiche, über die du selbst im nächsten Moment herfallen kannst? Warum beäugst du nicht hasserfüllt die wenigen Lebenden, die sich überhaupt noch in unsere Stadt trauen?«
Hilflos hob ich meine Hände und zuckte nur mit den Schultern. »Ich weiß nicht. Warum sollte ich die Lebenden hassen? Sie haben mir nichts getan.«
Die Augen der Dame wurden mit einem Mal hart wie Granit. »Die Lebenden verabscheuen uns. Sie würden uns lieber unter der Erde sehen als auf ihr wandelnd. Sie fürchten uns.«
»Ihr hasst sie deswegen doch auch nicht, oder?«, fragte ich zögerlich.
Ihre schemenhaften Lippen formten ein schmales Lächeln. »Ich lebe zu lange, um ewig einen Groll gegen sie zu hegen. Und es wäre zudem schlecht für das Geschäft. Aber ich bin auch ein Geist.«
»Und Geister sind keine Untoten«, führte ich den Gedanken laut zu Ende.
»Du bist der Bursche, der für Direflesh arbeitet, nicht wahr?«
Ich nickte nur stumm, während ich den Lederbeutel einsteckte. Beinahe fiel er durch ein Loch in meiner Hosentasche wieder heraus, und ich musste ihn auf der anderen Seite einpacken. Ich nahm mir noch im selben Moment vor, als erstes anständige Kleider zu kaufen, und einen Gürtel, an dem ich den Beutel festmachen würde.
»Er gehört zum grausamsten Abschaum in unserer Stadt. Lass dich nicht von ihm täuschen. Er mag verwirrt und verrückt wirken, aber er ist das genaue Gegenteil. Bleibe in seiner Gunst, solange du kannst, und verschwinde, sobald es dir möglich ist.«
Ich blickte die Frau ein letztes Mal an, nickte wieder und wandte mich dann von ihr ab. Meine Füße liefen wie von selbst die Stufen zur nächsten Ebene hinauf, während meine Gedanken noch um das Gespräch kreisten. Niemand gab mir eine Chance, noch lange unter ihnen zu weilen. Ich hatte bereits am eigenen Leib erfahren, wie impulsiv Direflesh sein konnte; trotzdem sah es nicht so aus, als würde er in nächster Zeit auf meine Dienste verzichten wollen. Aber womöglich hatte die geisterhafte Dame ja Recht, und er brauchte mich nur noch für eine kurze Zeit. Zum Beispiel so lange, bis er die letzte Zutat für seinen Todestrunk gefunden hatte.
Mir wurde allmählich unwohl, während ich darüber grübelte. Seufzend beschloss ich, mich später damit zu befassen und zuerst einmal ein wenig in meinen Büchern zu schmökern. Als ich aufsah, stellte ich verblüfft fest, dass mich meine Füße direkt zu der heruntergekommenen, viel zu engen Taverne geführt hatten, die mir Inessa gezeigt hatte. Nur zu gerne nahm ich an einem der leeren Tische Platz und nickte dem dürren Wirt zu. Er musste nicht einmal fragen, um zu wissen, was ich wollte, und noch bevor ich mein Buch – jenes über Nekromantie – ausgepackt und vor mir hingelegt hatte, stand bereits ein Krug mit der übel riechenden Flüssigkeit daneben.
Ich kramte rasch meinen Lederbeutel hervor, hielt dann aber kurz inne. Mit einem finsteren Blick und eiserner Miene starrte ich dem Untoten mitten in die Augen, der noch immer neben mir stand und mir seine geöffnete Hand entgegen streckte. »Du weißt, für wen ich arbeite.«
Ein hämisches Grinsen entblößte etliche Lücken zwischen seinen Zähnen, als er antwortete: »Deshalb kassiere ich dich auch gleich ab.«
Ich konnte spüren, wie sich meine Augen zu Schlitzen verengten. Als das Grinsen bestehen blieb, seufzte ich innerlich auf, schnürte aber scheinbar unberührt den Lederbeutel auf und zählte dem Wirt fünf Kupfermünzen in seine Hand ab. »Das sollte für die nächsten Runden reichen.«
Mein Gegenüber grunzte nur zufrieden und verzog sich wieder hinter seine Theke, wo er begann, mit einem schmutzigen Lappen schmutzige Krüge noch schmutziger zu machen.
Ich schlug das Buch auf und blätterte ein wenig durch die Seiten. Der Ledereinband knirschte dabei leise. Obwohl sich bestimmt niemand außer Direflesh selbst in seine Bibliothek verirrte, waren die Bücher zu einem großen Teil in einem erbärmlichen Zustand. Die wenigen, die ich eingepackt hatte, wiesen Risse auf, ihnen fehlten Seiten oder sie waren von Flüssigkeiten benetzt worden, die Löcher in das Pergament gebrannt und die Buchstaben ausgelöscht hatten. Ihr Besitzer ging nicht eben zimperlich mit ihnen um, und das Ausmaß der Zerstörung jagte mir immer wieder einen Schauer über den Rücken, wenn ich Zeuge davon wurde.
Nach kurzer Suche fand ich den Schattenblitz. Schlussendlich war es eine schwarze Kugel aus Magie, die alles auffraß, was sich ihr in den Weg stellte. Sie missachtete herkömmliche Rüstungen und brannte sich in das Fleisch des Unglücklichen, um es zu verzehren. Es schien kein schwerer Zauber zu sein, aber dennoch war er mächtig genug, um den Feind töten zu können. Einige der Illustrationen zeigten Leichen, in deren Brust etwa faustgroße Löcher klafften oder denen Gliedmaßen fehlten. Die Stümpfe sahen aus, als hätte man sie ihnen weggerissen.
Auch wenn das alles grausame Darstellungen waren und sie mir nicht gerade gefielen, faszinierten sie mich umso mehr, da sie so zerstörerisch waren. Wenn ich den Schattenblitz beherrschen würde, hätte ich mich bereits einigen Anweisungen Direfleshs mit Leichtigkeit widersetzen können. Zumindest war das etwas, worüber ich gerne und ausgiebig nachdachte.
Aber ich wusste nicht einmal, ob ich überhaupt dafür geschaffen war, Zauber zu weben. Ich konnte nicht sagen, welche Voraussetzungen man dafür benötigte, noch, ob ich sie besaß. Zwar schwirrte mir immer wieder der Zwischenfall mit dem Zombie im Wald durch den Kopf – das blaue Licht, das erstrahlt war, und der leblose Leichnam, der daraufhin neben mir gelegen hatte – aber ich wusste nicht, was das bedeuten zu bedeuten hatte. In jedem Fall konnte ich nicht auf Hilfe von Direflesh bauen, wenn ich mir irgendwelche magischen Künste beibringen wollte. Ich konnte höchstens versuchen, möglichst viel Wissen zu sammeln und es dann irgendwie anzuwenden.
Ich strich mir nachdenklich über das Kinn, während ich die Seiten ein ums andere Mal durchlas. Es klang alles so einfach, dass ich für einige Augenblicke meine Hand betrachtete, dann wieder die Zeichnung in dem Buch, dann meine Finger genau so wie dort gezeigt verbog. Ich atmete so tief aus, dass ich keine Luft mehr in meinen Lungen zu haben schien; in diesem Zustand konnte ich mich am besten konzentrieren.
So leise, dass es auch der Wirt nicht hören konnte, wisperte ich die fremd anmutenden Worte, die im Buch standen, und ließ zugleich meine Hand nicht aus den Augen.
Als ich das letzte Wort gesprochen hatte, spürte ich ein angenehmes Kitzeln in meinen Fingerspitzen. Aufgeregt wartete ich darauf, dass sich die schwarze Kugel zwischen ihnen bilden, sie wachsen und dann mit atemberaubender Geschwindigkeit hinfort fliegen würde.
Aber nichts geschah.
Enttäuschung machte sich in mir breit. Trotzig wiederholte ich die Worte noch einmal, aber wieder passierte nichts, und auch das Kitzeln blieb aus. Der Gedanke, dass ich es mir nur eingebildet hatte, wurde so unerträglich laut, dass ich mit der eben noch ausgestreckten Hand unwirsch meinen Krug krallte und den Inhalt in einem Zug in mich hinein goss. Murrend und über den Seiten brütend wartete ich darauf, dass der Wirt ihn füllte, und kaum dass das Lagerbier wieder darin herum schwappte, setzte ich den Krug von neuem an und leerte ihn bis zur Hälfte.
Wahrscheinlich war ich eben doch kein Magier, und das blaue Licht hatte ich mir am Ende auch nur eingebildet. Vielleicht war der Zombie einfach so tot umgefallen. Womöglich war seine Zeit abgelaufen, und was ihn zum Leben erweckt hatte, hatte ihn in genau dem Moment verlassen, als er mir in meine Nase hatte beißen wollen.
Ich verbrachte noch ein wenig Zeit damit, einige Seiten des Nekromanten-Buchs zu studieren, mir Wörter und Bewegungen zu merken. Auch wenn es nicht viel Sinn machte, hinterließ es ein gewisses Gefühl der Sicherheit, oder zumindest des Trotzes; ich tat etwas, das mir vielleicht einmal helfen würde. Wenn nicht, dann hatte ich meine Zeit zumindest mit etwas Interessantem verbracht.
Als ich den Krug vollends leerte, packte ich das Buch wieder in meine Ledertasche und machte mich auf. Ich musste nicht lange suchen, um einen Laden zu finden, der Kleidung verkaufte: Stoffroben waren in Undercity hoch im Kurs. Wie schon in Brill zuvor schien auch hier jeder, der Wert auf sich legte, eine reich verzierte Robe zu tragen, um seiner Position Ausdruck zu verleihen. Ich konnte all dem Gehabe nicht viel abgewinnen, aber außer Roben schien es praktisch nichts anderes zu geben. Als ich einen der untoten Schneider auf einfache Hosen und Hemden ansprach, lachte dieser mich aus. »Geh raus und grab einen von den Toten aus, wenn du solchen Tand willst!«, zwitscherte er mir noch hinterher, als ich ihm mit finsterer Miene den Rücken zukehrte und weiter suchte.
Tatsächlich hatten die wenigsten Schneider herkömmliche Kleidung im Angebot. Die meisten hatten sich auf Magierroben spezialisiert, wie mir eine überaus hässliche, aber zumindest nur unfreundliche Schneiderin erzählte. »Wir weben Zauber ein, machen sie robust gegen die Elemente, versuchen manchmal auch, sie gegen Schwerter und Äxte zu wappnen.« Als sie mir einen Blick zuwarf, schüttelte sie aber nur den Kopf. »Du bist kein Magier, und du könntest dir eine Robe nicht mal leisten, also verschwinde.«
Meine Suche endete erst bei einem Händler, der mir überaus dreckige, aber immerhin intakte Klamotten für einen unverschämt hohen Preis überließ. »Nicht die beste Qualität«, gab er grinsend zu, »aber vermutlich die einzigen Hosen, die man in ganz Undercity findet.«
»Sie sehen aus wie frisch aus dem Grab geklaut«, gab ich verärgert zurück, als ich aus der engen Umkleidekabine heraus trat, die hinter dem Stand aufgebaut worden war.
»Was glaubst du, warum sie so teuer sind?«, erwiderte der Verkäufer mit einem bösartigen Lachen.
Meine Hände hätten sich schon längst an die Kehle des kleinen Bastards gekrallt und sie heraus gerissen, wenn ich sie nicht mühsam unter Kontrolle gehalten hätte. Als er die Hand aufhielt und auf die Silbermünze wartete, die er für ein paar zusammen geschneiderte Leinen verlangte, betrachtete ich ihn mit einem möglichst vernichtenden Blick. »Ich bin der Gehilfe von Direflesh.«
Die Hand schloss sich für einen Moment, als der Händler erschrocken in meine Augen blickte; einen Moment später wurde seine Miene grimmig, und seine Hand öffnete sich wieder. »Wir hatten einen Preis vereinbart. Zahl ihn.«
Inessa kam mir wieder in den Sinn. Sie verstellte sich, um zu überleben.
Jetzt war wohl die Zeit gekommen, um herauszufinden, ob ich es ihr gleichtun konnte.
Meine linke Hand stieß nach vorne und packte den Untoten am Hals. Er war fast ein Kopf kleiner als ich und dürr wie ein wandelndes Gerippe; ich musste mich nicht einmal sonderlich anstrengen, um ihn nach oben zu heben. Einige panische Laute drangen aus seinem Mund hervor, verebbten jedoch sofort, als ich meinen Griff ein wenig verstärkte.
»Ich denke, du weißt, was ein Schattenblitz ist? Nick einfach.«
Sein Versuch misslang kläglich, aber dennoch war die Kröte eindeutig darum bemüht zu nicken. Seine Augen, die ohnehin schon weit aufgerissen waren, quollen geradezu hervor, als sie meine rechte Hand einige filigrane Bewegungen ausführen sahen und er die Formel für den Zauber vernahm. Mit seinen Fingern kratzte er von meinem Arm die Haut ab, ohne dass ich mich darum geschert hätte.
Beim letzten Wort verharrte ich für einen Moment. Der Händler hatte die Augen bereits geschlossen und blinzelte dann zögerlich, als das erwartete Ende doch nicht eintrat.
Ich rümpfte meine Nase in gespielter Verachtung und schmiss den Untoten dann einfach über seine Ladentheke hinweg. Er fegte dabei einige seiner Kleider vom Tisch herunter und landete mit ihnen im Dreck.
Um mich herum war es sehr still geworden. Als ich kurz über meine Schulter sah, konnte ich viele Untote sehen, die mich ausdruckslos ansahen. Die wenigen lebenden Wesen, die zwischen ihnen standen, betrachteten mich hingegen weniger leidenschaftslos: Ihre Gesichter spiegelten Hass und teilweise, wenn auch eher versteckt, Furcht wieder.
Dann, unter einigem Stöhnen und Grunzen, bahnte sich eine Monstrosität ihren Weg durch die Menge wie ein Riese durch eine Herde von Schafen. Die meisten der Schaulustigen waren schlau genug, dem Leichenberg auszuweichen, doch ein Untoter hatte ihn wohl zu spät bemerkt. Einen Moment später segelte er, von einer der mächtigen Fäuste getroffen, durch die Luft und landete weiter unten schreiend in den grünen Fluten von Undercity.
Eine noch immer panisch quietschende Stimme hinter mir schrie sofort: »Töte diesen Madenfresser! Töte ihn, augenblicklich!«
Ein einziger Blick genügte, um den Händler zum Schweigen zu bringen. Ich schaffte es tatsächlich noch immer, meine Maskerade aufrecht zu erhalten, auch wenn es inzwischen eher Verzweiflung war, die mir Kraft gab, anstatt wie vorher noch die berauschende Wirkung von Macht. Die Monstrosität kam direkt auf mich zu und blieb nur einen Schritt von mit entfernt stehen.
Als ich aufblickte und in das unförmige Gesicht sah, hätte ich fast zu lachen begonnen. Ich ließ mich schließlich zu einem schmalen Lächeln hinreißen, das Gordo zwar nicht mit seinem unförmigen, geöffneten Mund erwiderte, wohl aber mit seinen kleinen Augen. Wir mussten nicht einmal Worte wechseln, um uns zu verständigen.
Ich drehte mich noch einmal zu dem Händler um, als mir ein schlichter, schwarzer Umhang auffiel, der das Chaos unversehrt überlebt hatte und noch immer an seinem Haken hing. Ich nahm ihn herunter, warf ihn mir um die Schulter und schloss die Schnalle, um mir dann die angenähte Kapuze über den Kopf zu ziehen. Gordo war währenddessen bereits weiter marschiert und pflügte auf der anderen Seite durch die verblüffte Menge hindurch. Selbst die Verlassenen, die meinen kleinen Kampf beobachtet hatten, schauten der Monstrosität verwundert nach.
Als ich auf sie zuging, bildete sich rasch eine Gasse. Bei jedem meiner Schritte hörte ich gewisperte Worte und getuschelte Gespräche. Ich konnte die Blicke der Untoten und der Lebenden auf mich spüren, und in den Bruchteilen einer Sekunde beschloss ich, ihnen mit Schweigen und Verschlossenheit zu begegnen. Unbeteiligt, ohne meine Schritte zu verlangsamen oder jemanden eines Blickes zu würdigen, ging ich die Straße entlang und folgte ihr, bis ich endlich aus der Menge heraus trat. Dann bahnte ich mir einen Weg in die äußeren Viertel der Stadt.
Erst, als ich mich in einem der dunklen Gänge zwischen den größeren Arealen Undercitys befand, wagte ich es, stehen zu bleiben und mich umzusehen. Einige waren mir gefolgt, dessen war ich gewiss, aber ich musste sie inzwischen abgeschüttelt haben. Niemand war zu sehen, und was noch viel wichtiger war: niemand hatte mich aufgehalten.
Ich betrachtete fassungslos meine Hände. An meinem Arm hingen noch kleine Stücke der Haut weg, die der Händler aufgekratzt hatte, stumme Zeugen des Kampfes. Ich spürte, wenn auch nur schwach, den Stoff auf meiner Haut, und ein Gefühl, das mich von innen her auffraß.
Ich lachte. Ich lachte so laut, dass es sich in dem engen Gang anhörte, als würden hunderte verrückte Leute mit krächzender Stimme gemeinsam lachen.
Und während ich lachte, wurde mir klar, dass ich ab sofort etwas war, das ich nicht sein wollte.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: